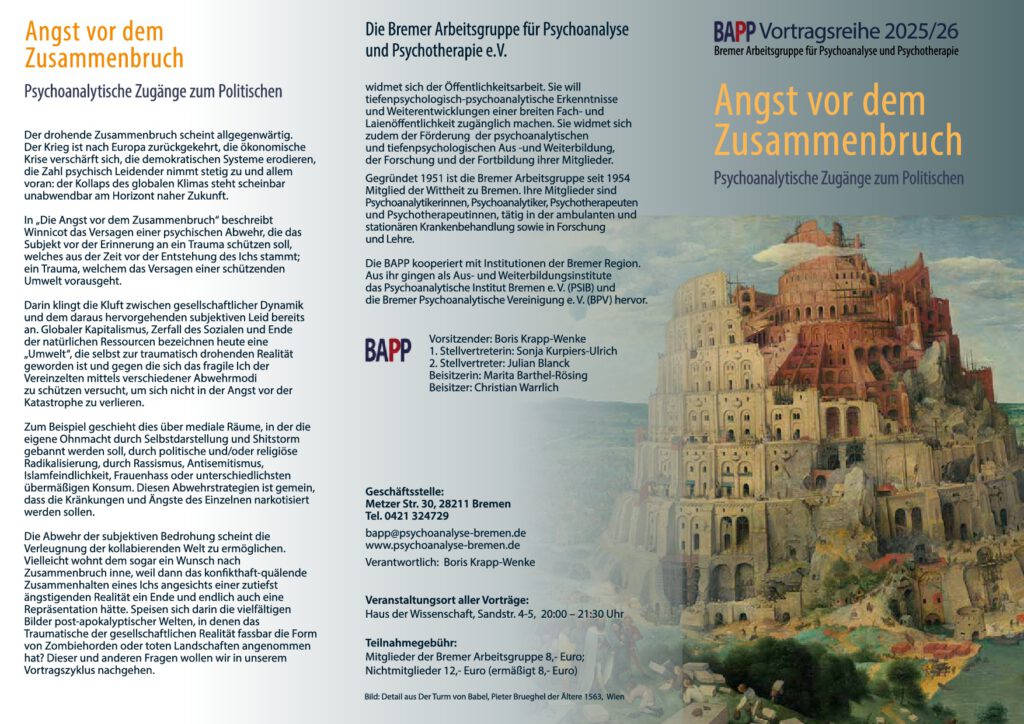Angst vor dem Zusammenbruch – Psychoanalytische Zugänge zum Politischen
Der drohende Zusammenbruch scheint allgegenwärtig. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt, die ökonomische Krise verschärft sich, die demokratischen Systeme erodieren, die Zahl psychisch Leidender nimmt stetig zu und allem voran: der Kollaps des globalen Klimas steht scheinbar unabwendbar am Horizont naher Zukunft.
In „Die Angst vor dem Zusammenbruch“ beschreibt Winnicott das Versagen einer psychischen Abwehr, die das Subjekt vor der Erinnerung an ein Trauma schützen soll, welches aus der Zeit vor der Entstehung des Ichs stammt; ein Trauma, welchem das Versagen einer schützenden Umwelt vorausgeht.
Darin klingt die Kluft zwischen gesellschaftlicher Dynamik und dem daraus hervorgehenden subjektiven Leid bereits an. Globaler Kapitalismus, Zerfall des Sozialen und Ende der natürlichen Ressourcen bezeichnen heute eine „Umwelt“, die selbst zur traumatisch drohenden Realität geworden ist und gegen die sich das fragile Ich der Vereinzelten mittels verschiedener Abwehrmodi zu schützen versucht, um sich nicht in der Angst vor der Katastrophe zu verlieren.
Zum Beispiel geschieht dies über mediale Räume, in der die eigene Ohnmacht durch Selbstdarstellung und Shitstorm gebannt werden soll, durch politische und/oder religiöse Radikalisierung, durch Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Frauenhass oder unterschiedlichsten übermäßigen Konsum. Diesen Abwehrstrategien ist gemein, dass die Kränkungen und Ängste des Einzelnen narkotisiert werden sollen.
Die Abwehr der subjektiven Bedrohung scheint die Verleugnung der kollabierenden Welt zu ermöglichen. Vielleicht wohnt dem sogar ein Wunsch nach Zusammenbruch inne, weil dann das konflikthaft-quälende Zusammenhalten eines Ichs, angesichts einer zutiefst ängstigenden Realität, ein Ende und endlich auch eine Repräsentation hätte. Speisen sich darin die vielfältigen Bilder post-apokalyptischer Welten, in denen das traumatische der gesellschaftlichen Realität fassbar die Form von Zombiehorden oder toten Landschaften angenommen hat? Dieser und anderen Fragen wollen wir in unserem Vortragszyklus nachgehen.
Die Referenten:
Dr. phil. Christoph Bialluch
Studium der Psychologie, Psychologischer Psychotherapeut (TP/PA), Psychoanalytiker, Mitglied der DPV, IPV und DGPT. Niedergelassen im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung in Berlin. Er promovierte an der Freien Universität Berlin über die Marx-Lektüren von Lacan und Derrida. Die Psychoanalyse und ihre gesellschaftlichen Bezüge bilden weiterhin einen Arbeitsschwerpunkt. Seit 2014 ist er im Bereich der selektiven und indizierten Extremismusprävention tätig, v. a. beim Projekt nexus – psychotherapeutische und psychiatrische Fallhilfen für die Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit (https://www.nexus-psychotherapeutisches-netzwerk.de/), das der Charité angegliedert ist. Ein Beispiel aus diesem Arbeitsfeld: Bialluch, C. & Sischka, K. (2021), Aufeinandertreffen: Ein psychoanalytischer Essay zu Begegnungen mit jungen Menschen, die sich islamistisch radikalisieren (Jahrbuch der Psychoanalyse 83). Derzeit ist er Vorsitzender des Berliner Psychoanalytischen Instituts.
Prof. Dr. phil. Robert Pfaller
Professor für Philosophie an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz, Österreich. Diverse Gastprofessuren, u. a. in Amsterdam, Berlin, Chicago, Oslo, Zürich. Seit 1993 Mitglied der Neuen Wiener Gruppe Lacan-Schule, Sektion Klinik. 1999 Gründungsmitglied der Wiener Forschungsgruppe für Psychoanalyse „stuzzicadenti“. 2000/2001 Mitglied der Forschungsgruppe „Antinomien der postmodernen Vernunft“ unter der Leitung von Slavoj Zizek am KWI Essen. 2007 ausgezeichnet durch das Psychoanalytische Seminar Zürich mit dem „Missing Link“-Preis für die Verbindung der Psychoanalyse mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen. 2015 „best book award“ durch das American Board and Academy of Psychoanalysis (ABAPsa). 2020 Paul-Watzlawick-Ehrenring der Ärztekammer Wien. Seit 2023 korrespondierendes Mitglied der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Veröffentlichungen u. a.: Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft. Symptome der Gegenwartskultur (2008), Die Ästhetik der Interpassivität (2008), Wofür es sich zu leben lohnt. Elemente materialistischer Philosophie (2010), Das Lachen der Ungetäuschten. Die philosophische Würde der Komödie (2025).
Dr. med. Diana Pflichthofer
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalytikerin und Gruppenanalytikerin, niedergelassen in eigener Praxis in Soltau. Dozentin, Supervisorin und Lehranalytikerin für Einzel- und Gruppenanalyse. Buchautorin. Macht neuerdings auch mit großer Freude pferdegestützte Psychotherapie. Arbeitsschwerpunkte: Behandlungstechnik, Methodenreflexion, Traumatherapie. Letzte Buchpublikation: Die Psychoindustrie (2024).
Prof. Dr. Jan Distelmeyer
Medienwissenschaftler, lehrt Mediengeschichte und -theorie im Kooperationsstudiengang Europäische Medienwissenschaft (EMW) der Fachhochschule Potsdam und Universität Potsdam. Gründungsmitglied des Brandenburgischen Zentrums für Medienwissenschaften (ZeM), Mitglied des Stiftungsrats der Deutschen Kinemathek sowie des Beirats der Gesellschaft für Medienwissenschaft. Zu seinen Veröffentlichungen zählen u.a. Kritik der Digitalität (2021), Machtzeichen. Anordnungen des Computers (2017), Katastrophe und Kapitalismus. Phantasien des Untergangs (2012).
Dr. phil. Leopold Morbitzer
Studium der Psychologie in Tübingen, Promotion an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin über den Laios-Komplex (2024); wissenschaftlicher Förderpreis der DPV-Stiftung für „Zur Psychoanalyse des Glücks“ (2012); Psychoanalytiker, Lehranalytiker und Supervisor (DPV/IPA/DGPT); Leiter des Ausbildungsausschusses der Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft Stuttgart-Tübingen (2022-2025), zahlreiche Veröffentlichungen u. a. zur Bedeutung kasuistischer Seminare in der psychoanalytischen Ausbildung. Bücher: Sonnyboy – Die Angst vor dem Zusammenbruch (2023), Der Laios-Komplex und die Begegnung am Dreiweg. Psychoanalytische und kulturwissenschaftliche Untersuchungen (2024), Das elterliche Unbewusste und der Laios-Komplex (Psyche, 2025); www.leopold-morbitzer.de
Prof. Dr. Christine Kirchhoff
Professorin für Psychoanalyse, Subjekt- und Kulturtheorie an der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin (IPU), approbierte Psychotherapeutin (AP/TP) und Psychoanalytikerin (DPV/IPA) in eigener Praxis. Studium an der Universität Bremen, Diplom 2003, Promotion ebendort mit einer Arbeit über das psychoanalytische Konzept der Nachträglichkeit (2007). Arbeitsschwerpunkte: Metapsychologie und psychoanalytische Konzeptforschung, Psychoanalyse in der Kritischen Theorie, Kritik der (psychoanalytischen) Zeitdiagnostik, Psychoanalyse und Klimawandel, Kritik des Antisemitismus. Auswahl aktueller Publikationen: Laplanche kritisch wiedergelesen. Beiträge zu Körper, Sexualität und Verführung (hrsg. mit A. Lahl, 2025). Kein gutes Thema für die Zukunft. Wie wir den Klimawandel erleben: Über die folgenreiche Abwehr einer bedrohlichen Realität (mit A. Lilge-Hartmann, M. Bechtoldt und C. Kaufhold, 2024). Bindung und Entbindung. Ein politisch-psychoanalytischer Versuch über Identifizierung, Solidarität und Angst (in: Decker & Türcke, Kritische Theorie – Psychoanalytische Praxis, 2024).Studium der Geschichte und Philosophie in Zürich. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Innsbruck und lehrte an zahlreichen Universitäten. Heutige Arbeitsschwerpunkte sind die Verbindung von Lacanscher Psychoanalyse, Marxismus und Theorien des Totalitarismus. Sie promovierte an der Universität Zürich zu Luce Irigarays Denken der sexuellen Differenz. Sie initiierte den »Gender-Streit«, eine Kontroverse um die theoretischen Grundlagen des Gender-Begriffs. Für das Stadttheater Bern schrieb sie 2009 die Lesung »Nehmen Sie Ihr Gender selbst in die Hand, Madam!«. WS 2016/17 hatte sie die Klara-Marie-Faßbinder Gastprofessur an der Hochschule Ludwigshafen inne. Für ihr feministisches Engagement den Ida Somazzi-Preis (2016). Sie ist Mitherausgeberin der beiden Bände: Postödipale Gesellschaft und Sexuelle Differenz in der postödipalen Gesellschaft (mit M. Frühauf u. A. Hartmann, 2022) sowie Sexuelle Differenz (mit A. Hartmann, 2022).